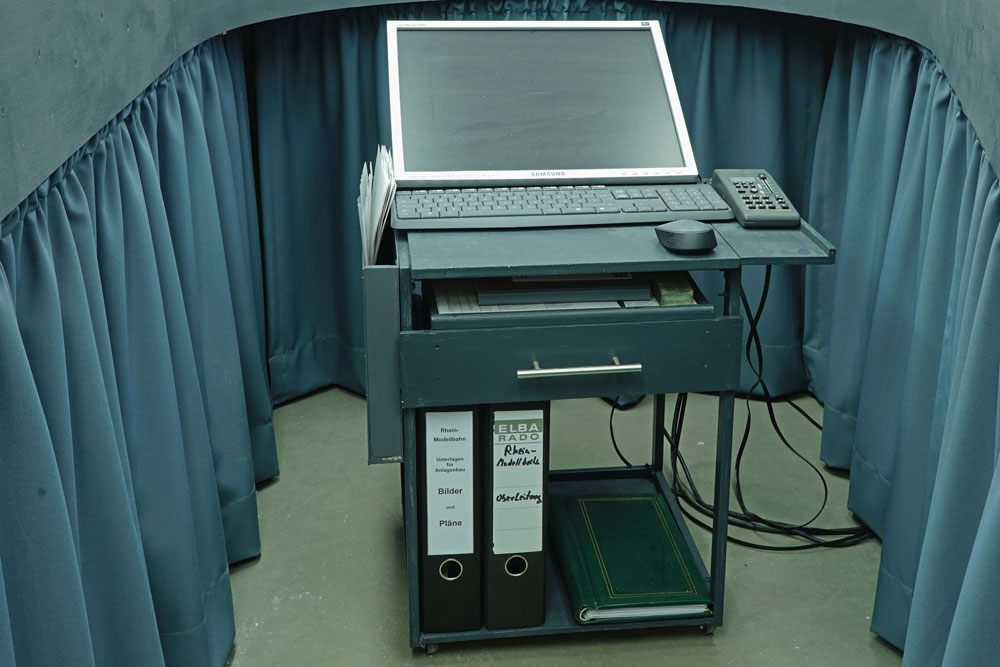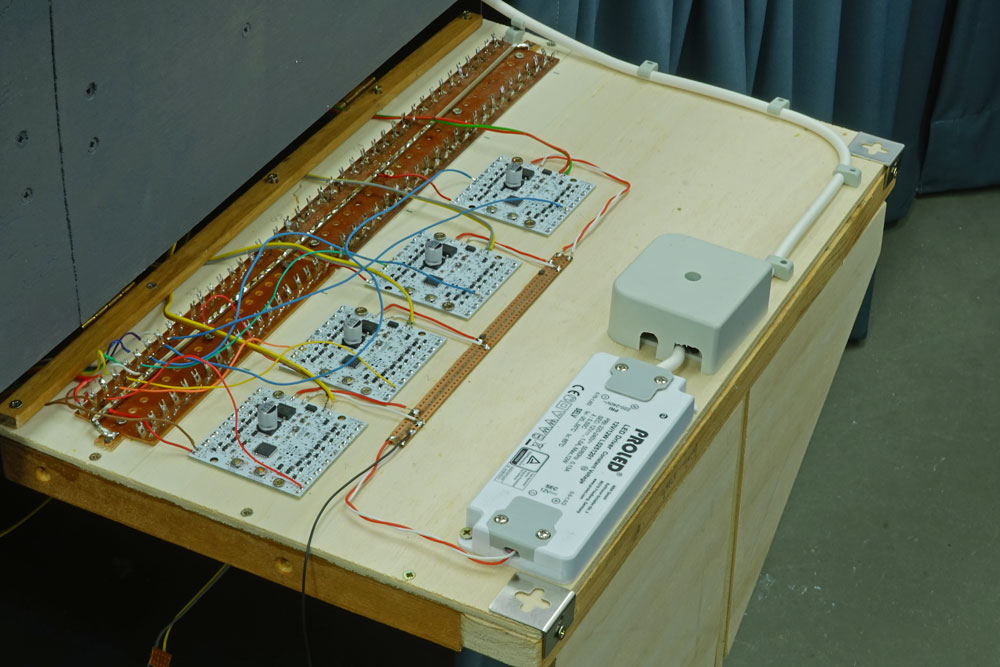Liebe Modellbahnfreunde,
seit vielen Jahren habe ich Rheingoldwagen bestellt, die 1983 ihre Premiere hatten. Leider wurden die Waggons trotz Ankündigung nicht produziert. Erst jetzt konnte ich die ersten 4 Wagen von Rivarossi in den Händen halten. Heute kann ich euch daher erstmals einen Rheingold 83 zeigen, der leider noch nicht komplett ist.
Rheingold 83
Nachdem der legendäre Rheingold aus dem Jahr 1928 nach dem Zweiten Weltkrieg als F-Zug und Trans-Europ-Express-Zug (TEE) wieder auferstanden war, erlebte er ab Sommerfahrplan 1983 seine letzte Blühte. Ab dem 29. Mai 1983 gab es nur noch zwei TEE-Züge auf deutschen Strecken. Zum Einen der Mediolanum (München - Mailand) und zum Anderen den Rheingold im neuen Gewandt (Amsterdam CS - Basel SBB).
Mit neuem Konzept sollten die rückläufigen Fahrgastzahlen gestoppt werden. In den Sommermonaten sollte ein Flügelzug ab Mannheim über Stuttgart und Augsburg bis München die Attraktivität steigern. Das ausgewählte Wagenmaterial wurde aufgearbeitet. Insgesamt 27 Waggons standen für den Rheingold im Mai 1983 bereit. Außen markierte ein orangener Streifen zwischen Brüstung und Fenstern den neuen Zug. Eine größere Neuerung betraf die drei neu gestalteten Clubwagen, die aus Abteilwagen Apmh 121 umgebaut wurden. Dieser Fahrzeugtyp lehnte sich wohl an den erfolgreichen TUI-Treff im Turnusverkehr an. Kernstück des Clubwagen war eine über 6 Meter lange Theke. Kiosk und Schauvitrinen ergänzen den mit Drehstühlen und kleinen Tischen ausgestatteten Großraum.
Die Stammstrecke des Rheingold als TEE 7 führte von Amsterdam über Köln und Mainz bis nach Basel (SBB). Zwischen Emmerich und Mannheim wurden planmäßig neun Waggons eingesetzt. Den Flügelzug TEE 17 bildeten ein Apmz Großraumwagen, ein WGmh Clubwagen und ein Avmz Abteilwagen. Die Rheingold-TEE Richtung Norden (TEE 6 und Flügelzug TEE 16) wurden in Mannheim vereint. Dabei wurden die Waggons des Flügelzuges vor den Regelzug gesetzt, was ein absetzten der Lokomotive erforderlich machte. In den Winterfahrplänen verkehrten die Flügelzüge nicht. Der Clubwagen lief dann im Stammzug Emmerich - Basel mit. Im Sommerfahrplan gab es jeweils einen Kurswagen Amsterdam - Brig und Amsterdam - Chiasso. Im Winterfahrplan fuhr der Kurswagen nach Chiasso nur bis Chur.
Da der wirtschaftliche Erfolg des Rheingold 83 ausblieb, wurde schon im Sommerfahrplan 1985 das Konzept geändert. Der Flügelzug TEE 17/16 fuhr ab Mainz auf direktem Weg nach München. Im Sommerfahrplan sogar bis Salzburg.
Vor dem Rheingold Stammzug kam die E 103 zum Einsatz. Der Flügelzug wurde unterschiedlich bespannt. Es kamen die E 110, E 111, E 112 und E 103 zum Einsatz.
Am 30. Mai 1987 verkehrte des Rheingold zum letzten Mal. Der Zugname verschwand aus den Kursbüchern der Deutschen Bundesbahn und damit ein Stück Eisenbahngeschichte bis heute. Wir alle wissen, was aus der einstmals in der Regel pünktlichen Bahn geworden ist. Die Hoffnung auf einen neuen Rheingold im Regelbetrieb können Eisenbahnfreundinnen und -Freunde also getrost vergessen.
Laufweg, Wagenreihung und Bespannung
Laufweg Richtung Süden TEE 7/6
BR 103.1 (auch mit Pfeil-Sonderlackierung 103 109-5)
Amsterdam CS - Utrecht CS - Arnheim - Emmerich - Duisburg Hbf - Düsseldorf Hbf - Köln Hbf - Bonn Hbf - Koblenz Hbf - Mainz Hbf - Mannheim Hbf - Karlsruhe Hbf - Baden-Baden - Freiburg Hbf - Basel Bad Bf - Basel SBB
TEE 17/16
BR 112, BR 111 und BR 110
Mannheim Hbf - Heidelberg Hbf - Eberbach (Neckar) - Heilbronn Hbf - Stuttgart Hbf - Schwäbisch Gemünd - Aalen - Nördlingen - Donauwörth - Augsburg Hbf - München Hbf
Sommerfahrplan 1983 Richtung Süden TEE 7
1 Apmz Emmerich - Basel SBB
2 Avmz Amsterdam - Brig
3 Avmz Amsterdam - Chiasso
4 WRmh Amsterdam - Basel SBB
5 Avmz Amsterdam - Basel SBB
6 Avmz Amsterdam - Basel SBB
7 Apmz Amsterdam - München (TEE 17)
8 WGmh Amsterdam - München (TEE 17)
9 Avmz Amsterdam - München (TEE 17)
Sommerfahrplan 1983 Richtung Norden TEE 6
1 Avmz München - Amsterdam (TEE 16)
2 WGmh München - Amsterdam (TEE 16)
3 Apmz München - Amsterdam (TEE 16)
4 Avmz Basel SBB - Amsterdam
5 Avmz Basel SBB - Amsterdam
6 WRmh Basel SBB - Amsterdam
7 Avmz Chiasso - Amsterdam
8 Avmz Brig - Amsterdam
9 Apmz Basel SBB - Emmerich
1. Klasse Großraumwagen Apmz 122 Rheingold 83
Ab 1962 beschaffte die DB für den Rheingold die ersten Großraumwagen vom Typ Ap4vüm, die ab 1966 als Apmz 121 bezeichnet wurden. Deren Bestellungen liefen 1973 aus. Doch der Bedarf bestand weiter. So sollten weitere Waggons dieser Bauart beschafft werden. Der technische Fortschritt führte in den neuen Wagen zu so vielen Veränderungen, dass die Serie aus 35 Einheiten ab 1975 eine neue Bauartbezeichnung bekamen. Es entstand der Apmz 122. Die ersten 15 Wagen lieferte Wegmann in Kassel. Die restlichen 20 Wagen die Waggon Union in Berlin. Alle Apmz 122 waren für 200 km/h zugelassen. Die Eigenmasse betrug 47.000 kg.
Der Apmz 121 hatte pro Seite 16 Fenster mit einer Breite von 900 mm. Der Apmz 122 hatte davon nur noch 14 Fenster. Die äußeren Fenster bekamen eine Breite von 1.400 mm. 51 Sitzplätze wurden angeboten. Länge über Puffer: 26.400 mm.
Das Modell des Rheingold-Großraumwagens mit der Nummer 61 80 18-90 069-5 hat den Heimatbahnhof München Hbf angeschrieben Unter der Klassenkennzahl sind Raucher-Nichtraucher Signet angebracht. Es ist das Untersuchungsdatum 10.5.83 zu finden. Auf den Zuglaufschildern steht Basel SBB - Emmerich. Unter den Fenstern ist der orangefarbene Kennstreifen (80 mm breit) aufgebracht. Anders als die Regelbauart lautet die angegebene Sitzplatzzahl nur 48 statt 51 Plätze. Das Vorbild des Waggons ist bei Wegmann in Kassel 1975 gebaut. Länge über Puffer 303 mm.
Modell Rivarossi Nr. HR4346-3 (Set aus vier Wagen)
 1. Klasse Abteilwagen Avmz 111 Rheingold 83
1. Klasse Abteilwagen Avmz 111 Rheingold 83
Das Vorbild des Abteilwagens wurde für den Rheingold 1962 beschafft. Über 10 Jahre entstanden 267 Waggons dieser Bauart, die zunächst als Av4üm-62 bezeichnet wurde. Ab 1966 änderte sich die Bezeichnung in Avmz 111. Je nach technischer Ausstattung waren die Abteilwagen für 160 km/h oder 200 km/h zugelassen.
Im Jahr 1983 wurden 15 Wagen für den TEE Rheingold aufgearbeitet. Dabei erhielten sie Schwenkschiebetüren. Alle 15 bei Wegmann in Kassel gebauten Waggons kamen aus den Lieferjahren 1973 und 1974 und gehörten damit zur letzten Lieferserie. Weitere Herstellerfirmen des Avmz 111 waren die Waggon- und Maschinenbau GmbH (WMD), Messerschmidt-Bölkow-Blohm (MBB) und Orenstein & Koppel (O & K). Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 200 km/h und die Eigenmasse bei 43 Tonnen. Der Abteilwagen verfügt über 54 Sitzplätze. Die Länge über Puffer beträgt 26.400 mm. Wenige der Abteilwagen dürften auch 2025 noch bei verschiedenen Bahnunternehmen im Einsatz sein.
Die TEE Rheingold-Abteilwagen-Modelle mit den Nummern 61 80 19-90 203-9 und 61 80 19-90 202-1 haben in der BD München den Heimatbahnhof München Hbf. Das Untersuchungsdatum 8.4.83 und der Zuglauf Basel SBB - Amsterdam CS sind angeschrieben. Unter den Klassenkennzahlen sind Raucher-Nichtraucher Signet angebracht. Auf der Brüstung ist der orangefarbene Kennstreifen zu sehen.
Modell Rivarossi Nr. HR4346-1 und -2 (Set aus vier Wagen)
Avmz 111 Nr. 61 80 19-90 202-1

Avmz 111 Nr. 61 80 19-90 203-9
 Speisewagen WRmh 132 Rheingold 83
Speisewagen WRmh 132 Rheingold 83
Das Vorbild des Speisewagens wurde ab 1964 in verschiedenen Varianten gebaut. Zunächst wurde er in der Epoche III als WR4üm-64 gezeichnet. Die 27 Waggons der Bauart verfügten über Minden-Deutz-Drehgestellen. Je nach Bauart lag die Höchstgeschwindigkeit bei 160 km/h oder 200 km/h (mit Schlingerdämpfern). 42 Sitzplätze wurden angeboten. Je nach Einsatzbereich und Einsatzzeit waren die Speisewagen unterschiedlich gestaltet. Die DSG sorgte für Personal und Versorgung mit Speisen und Getränken an Bord. Ich gehe von einem Bau alles 27 Waggons bei Orenstein & Koppel in Berlin-Spandau aus.
Für den TEE Rheingold wurden 1983 drei Speisewagen mit den Nummern 61 80 88-80 215-3, 61 80 88-80 217-7 und 61 80 88-80 221-9 aufgearbeitet.
Die Länge über Puffer betrug 27.500 mm bei einer Eigenmasse von 48.000 kg. Bei dem TEE-Rheingold Speisewagen betrug die Eigenmasse 51 Tonnen.
Das Modell des 1. Klasse TEE-Speisewagen mit der Nummer 61 80 89-70 215-3 ist bei der BD Karlsruhe mit Heimatbahnhof Basel Bad angesiedelt. Der Zuglauf Basel SBB - Amsterdam CS ist angeschrieben. Das Untersuchungsdatum lautet 13.5.83. Der Waggon ist mit einem orangefarbenem Kennstreifen versehen. Auf beiden Seiten ist ebenfalls in orange der Schriftzug Restaurant zu finden. Das Vorbild wurde 1966 bei Orenstein & Koppel in Berlin gebaut. Die Länge über Puffer beträgt 316 mm.
Modell Rivarossi HR4346-4 (Set aus 4 Wagen)
 Rheingold 1987
Rheingold 1987
Da ich ja erst vier Rheingold-Wagen geliefert bekommen habe, suchte ich nach einem passenden Bild für den "Kurzzug". Im Buch "Rheingold - Legende auf Schienen" von Peter Goette habe ich etwas passenden gefunden. Auf Seite 151 ist der TEE 15 Rheingold unterhalb der Burg Rheinstein zu sehen. Die ersten vier Waggons hinter der BR 103 sind Apmz 122, Avmz 111, WRmh 132 und ein weiterer Avmz 111. Ein weiterer Apmz 111 ist noch zu sehen.
Der TEE Rheingold auf der Fahrt Richtung Süden zwischen Bett- und Kammerecktunnel